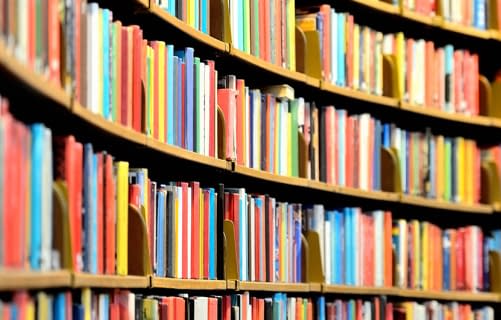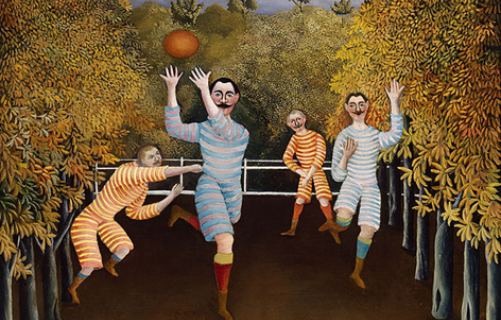Kurze Zusammenfassung
Er ist ausgebildeter Architekt, arbeitete jahrzehntelang als Szenograf in der Filmbranche und ist seit jeher bildender Künstler. In diesem Interview mit art24 spricht German Pizzinini über die Wechselwirkungen zwischen seinen beruflichen Stationen und seiner Malerei, über die inhaltliche Ausrichtung seiner Werke und darüber, wie gesellschaftliche Entwicklungen in seine künstlerische Konzepte einfliessen.
Sie haben in Ihrem Leben bereits viele verschiedene Rollen übernommen. Besonders bemerkenswert ist Ihre Arbeit als Kulissenbauer in der Filmbranche, bevor Sie sich ganz der bildenden Kunst zuwandten. Inwiefern fliessen Ihre Erfahrungen aus der Filmwelt und die visuellen Eindrücke aus dem Kulissenbau noch in Ihre Malerei ein?
Zunächst möchte ich etwas klarstellen: Ich habe die Kulissen nicht gebaut – ich habe sie entworfen, geplant und ihre Ausführung geleitet. Ich war kein Bühnenbauer, sondern Szenograf ( Im englisch sprachigen Raum ist der Titel „Production Designer"). Szenografie ist Teil der Bildenden Kunst. Bei jeder Produktion richtete ich mir mein eigenes Atelier ein, in dem ich parallel immer auch der Malerei nachging. Die Aussage oder die Metapher einer Szene, für deren bildlichen Rahmen ich zuständig war, stellte für mich stets eine Herausforderung dar, die ich künstlerisch umsetzen wollte.

Sie haben auch als Architekt gearbeitet. Haben auch die zeichnerischen Elemente der Architektur Spuren in Ihrer Malerei hinterlassen?
In der Architektur spielt die reale, räumliche und dreidimensionale Auseinandersetzung eine große Rolle – insbesondere die Perspektive. Diese Erfahrung war für die räumlich-farbige Umsetzung in meinen Bildern äußerst hilfreich.
Warum haben Sie sich schliesslich für eine Karriere als Bildender Künstler entschieden? Was hat Sie daran mehr gereizt als die Filmsets und die Architektur?
Wie schon erwähnt: Bildender Künstler war ich immer – nur die Schwerpunkte haben sich im Laufe der Zeit verschoben. Während meiner architektonischen Tätigkeit habe ich mich vorwiegend mit grafischen Ausdrucksformen beschäftigt. Mit dem Einstieg ins Szenenbild für Filmproduktionen vor 45 Jahren wurde die Farbe ein wichtiges Element – und zwangsläufig habe ich mich wieder vermehrt der Malerei zugewandt.
Sie erwähnen, dass Sie in der Kunst Geschichten erzählen wollen. Warum ist das Geschichten-Erzählen für Sie wichtig? Und warum ist die Malerei für Sie dafür das richtige Medium?
Die Nicht- Informelle Malerei dient mir persönlich eher als Studienzweck zur Erkundung von Farbkompositionen, Raumwirkung und emotionaler Tiefe. Als eigenständiges Kunstwerk – was ich durchaus respektiere – empfinde ich sie oft nur dekorativ. Ich hingegen möchte dem Betrachter / der Betrachterin etwas mitteilen, einen Anreiz zum Nachdenken geben: Sei es etwas Persönliches, Aktuelles oder schlicht ein Empfinden – umgesetzt mit realistischen Elementen, als Metapher oder symbolisch. Die Malerei ist für mich das beste Ausdrucksmittel.
Aus Ihrem Lebenslauf habe ich entnommen, dass Sie 1976 eine Künstlergruppe mitbegründeten, die sich die „Kritischen Naturalisten“ nannte. Der Bewegung ging es darum, sich dem Trend der abstrakten Kunst entgegenzustellen. War Abstraktion damals auch ein Thema, das Ängste auslöste? Was sehen Sie als die besondere Stärke der figurativen Kunst?
In den 1970er-Jahren war die bildende Kunst, besonders in Wien, stark politisch geprägt. Realismus – egal in welcher Form – galt als links und wurde teils als kommunistisch verschrien. Die Künstler waren meist sozial orientiert, distanzierten sich aber von politischen Organisationen – mit wenigen Ausnahmen. Abstrakte Kunst hingegen galt als rechts-konservativ. Nicht umsonst war ihr prominentester Vertreter ein Monsignore.
Die abstrakte Kunst – vor allem die informelle – stellt inhaltlich keine direkte Herausforderung dar. Sie kann daher keine Angst auslösen, höchstens Unverständnis, Gleichgültigkeit oder Ablehnung. Man muss sich intensiv mit ihr auseinandersetzen, um einen Zugang zu finden. Die figurative Malerei hingegen – selbst in verfremdeter Darstellung – bietet weitaus mehr Möglichkeiten, inhaltlich eine Reaktion beim Betrachter/der Betrachterin auszulösen.

Wie stehen Sie heute zur abstrakten Kunst?
Ernstzunehmende abstrakte Kunst kann für mich durchaus eine Herausforderung sein und ich respektiere sie. Es gibt jedoch auch spekulative Kunst, die für mich keinerlei Bedeutung hat.
Wenn Sie auf diese Zeit zurückblicken, würden Sie sich heute wieder dieser Bewegung anschliessen? Wie hat diese Phase Ihr künstlerisches Selbstverständnis geprägt?
Abgesehen davon, dass ich heute keinerlei Ambitionen mehr habe, Mitglied einer Gruppe zu sein, würde ich mich wahrscheinlich nicht noch einmal anschließen. Der anfängliche Enthusiasmus und die Dynamik einer Gruppe verflüchtigen sich schnell – was bleibt, ist ein geselliges Beisammensein. Das war mir zu wenig.
Nach der Auflösung der Gruppe im Jahr 1983 haben Sie den Stil für sich selber weiterentwickelt. Welche Veränderungen sind in Ihrer Kunst seitdem sichtbar? Was hat sich in Ihrer Arbeitsweise und Ihrem Ausdruck verändert?
Ich habe die Gruppe bereits 1979 verlassen. Danach wurde ich stärker durch mein neues berufliches Umfeld beeinflusst und durch die Möglichkeit, Museen in ganz Europa zu besuchen. Dadurch hatte ich plötzlich einen intensiveren Zugang zur Symbolik, zur Metapher und auch zur Abstraktion.
Sie beschreiben Ihren Stil heute als «barocken Expressionismus». Was genau bedeutet dieser Begriff für Sie, und sehen Sie eine Verbindung zwischen den barocken und expressionistischen Epochen?
Den Begriff „barocker Expressionismus“ hat meine Frau geprägt. Er beschreibt die Üppigkeit des Barocks kombiniert mit der Farbpalette der Expressionisten – helle, leuchtende Farben, dynamisch und mit Tempo verarbeitet.
Der Zyklus «Zeit der Angst» ist eine zentrale Arbeit von Ihnen, die im Kontext der Flüchtlingskrise 2015/2016 entstand. In dieser Zeit fand eine Fluchtbewegung von rund zwei Millionen Menschen in die Europäische Union statt. Was für Geschichten und Gefühle greifen Sie in Ihrer Arbeit auf? Inwiefern ist die Werkserie auch heute noch relevant?
Das Problem besteht in Europa bis heute. Allein in Österreich gibt es jährlich etwa 26.000 Asylanträge – die rund 90.000 ukrainischen Staatsangehörigen nicht mitgerechnet. Anlass für den Zyklus war eine Dokumentation über die Flüchtlingssituation in internationalen Lagern sowie im größten österreichischen Auffanglager Traiskirchen.
Der Zyklus besteht aus sechs thematisch gegliederten Bildern: die Verursacher der Angst, die Menschen mit Angst und die Hüter der Angst. Rassismus und Fremdenfeindlichkeit sind in Österreich weitaus verbreiteter, als es offiziell dargestellt wird. Mit der Ausstellung wollte ich diese Problematik sichtbar machen. „Migration und Flucht begleiten die Menschheitsgeschichte seit jeher – bedingt durch Klimaveränderungen, bewaffnete Konflikte oder Naturkatastrophen. Neu wäre hingegen ein Konzept der wechselseitigen Integration.“


In Ihrer Arbeit «Kaffeehaus» greifen Sie soziale Veränderungen durch neue Technologien und Medien auf. Würden Sie die Malerei in diesem Kontext als eine Form der Gegenbewegung verstehen? Wenn ja, warum?
Nein – ich sehe die Malerei nicht als Gegenbewegung. Sie positioniert sich heute im Spannungsfeld zwischen traditioneller Kunst und neuen Technologien. Im Gegensatz zur flüchtigen Bilderflut sozialer Medien bietet die Malerei Raum für Reflexion, Konzentration und handwerkliche Tiefe. Sie ist nicht auf Effizienz, sondern auf Auseinandersetzung ausgerichtet. In diesem Sinne ist Malerei heute nicht überholt – sondern relevanter denn je.

In vielen Ihrer Arbeiten stellen Sie moralische und ethische Fragen und reflektieren über das Zusammenleben der Menschen. Nutzen Sie Kunst also als ein Werkzeug, um auf gesellschaftliche Missstände oder globale Probleme aufmerksam zu machen? Ist Ihre Kunst immer in einem grösseren Kontext der Weltverhältnisse verortet?
Ja, das tue ich. Die Malerei ist für mich das Ausdrucksmittel, das ich am besten beherrsche, um gesellschaftlich relevante Themen einer breiteren Öffentlichkeit mitzuteilen.
Kunst hat die Fähigkeit, Menschen zum Nachdenken zu bringen. Glauben Sie, dass Kunst eine Verantwortung hat, gesellschaftliche Themen anzusprechen, oder sollte sie auch einfach als ästhetischer Genuss verstanden werden?
Egal wie Kunst verwendet wird – sie hat immer eine gesellschaftliche Wirkung. Daraus ergibt sich auch eine Verantwortung.
Gibt es weitere Themen / Motive, die noch in Ihnen «schlummern» und die Sie in Zukunft unbedingt umsetzen möchten? Möchten Sie uns diese verraten?
Es gibt noch viele Themen und Motive, aber ich plane nicht im Voraus. Meine Themen entstehen meist spontan – aus Erlebnissen, zufälligen Situationen oder gesellschaftlichen Ereignissen.

Könnten Sie sich vorstellen, neben der Malerei mit anderen Techniken zu experimentieren? Wenn ja, welche Techniken würden Ihnen gefallen?
Wenn ein Thema es verlangt, kann ich mir jede Art von Material vorstellen. 1986 habe ich zusammen mit VALIE EXPORT zur Ausstellung «Beuys zu Ehren» im Lenbachhaus in München eine Installation aus Kupfer, Filz, Kunststoff und Öl geschaffen. Zur gleichen Zeit entstanden auch einige Plastiken aus Stein und Metall.
Wo die Leinwand zur Stimme wird

Das Oeuvre von German Pizzinini zeigt zeugt von einem konsequenten künstlerischen Weg – und dabei immer vom Wunsch getragen war, mehr zu zeigen als schöne Bilder: Sie möchten erzählen, hinterfragen, aufrütteln. Die realistische Darstellung, angereichert mit Symbolik und Metaphern, dienen dem Künstler als Mittel zur Reflexion über gesellschaftliche Entwicklungen, persönliche Eindrücke und kollektive Erfahrungen. Dadurch ist seine Malerei tief im Heute verankert. Und genau darin liegt die Relevanz von German Pizzinini. Er zeigt: Kunst darf berühren, irritieren und fordern – gerade in einer Zeit, in der allzu vieles an der Oberfläche bleibt.
Entdecken Sie weitere Werke von German Pizzinini auf seinem Profil bei art24 – und lassen Sie sich inspirieren von Bildern, die Geschichten erzählen.
Das Interview wurde geführt von: Yvonne Roos
Autor:in: German Pizzinini